ADHS und Autismus diagnostizieren lassen – ja oder nein?
Diese Frage hat mich jahrelang begleitet wie ein nerviger Ohrwurm, der immer wieder auftaucht, wenn man eigentlich gerade mal Ruhe bräuchte. Und heute bekomme ich sie selbst oft gestellt – von Menschen, die an dem Punkt stehen, an dem ich damals war: unsicher, erschöpft, überfordert.
Im Oktober 2024 habe ich meine ADHS-Diagnose bekommen. Die habe ich privat bezahlt, weil es anders einfach nicht ging. Davor lag eine ziemlich zermürbende Odyssee durch diverse Psychiaterpraxen. Nicht selten endete sie schon an der Rezeption: „Wir nehmen keine neuen Patienten.“ Keine Rückrufe, keine Wartelisten, keine Perspektive. Ich erinnere mich noch, wie ich nach einem dieser Versuche weinend im Auto saß – weil es mich jedes Mal unfassbar viel Kraft gekostet hat, überhaupt dort aufzuschlagen. Und das, obwohl ich in einer Phase war, in der ich sowieso schon auf dem Zahnfleisch kroch.
Die Menschen in den Praxen trifft keine Schuld, im Gegenteil! Es ist ein systemisches Problem. Eine flächendeckende Versorgung? Klingt gut auf dem Papier. In der Realität bedeutet es oft: Monate- oder jahrelanges Warten, oder gleich die nächste Absage. Erst bei einer überregionalen Praxisgruppe hatte ich endlich Glück, und es ging plötzlich ganz schnell.
Aber warum erst so spät? Warum habe ich mir das alles überhaupt angetan? Und war es am Ende das Richtige?
Spoiler: Ja. Aber (und das ist wichtig) es ist komplizierter, als man denkt.
*Der Artikel hat eine ungefähre Lesezeit von 25 Minuten.
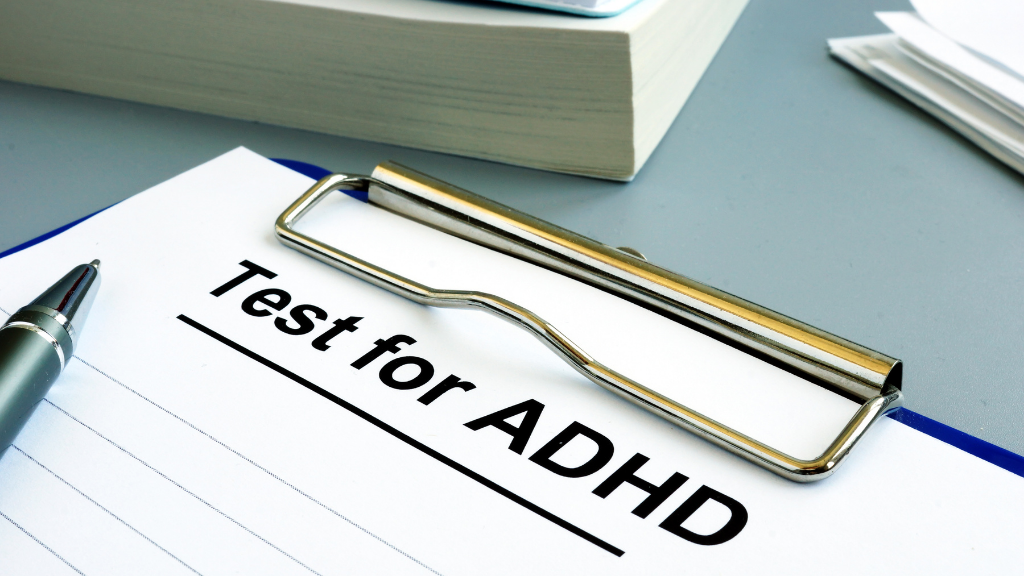
Mein Weg zur Diagnose – oder: Wie ich drei Jahre lang „vielleicht hochsensibel“ war
2020 war ein Wendepunkt. Ich wurde trocken. Raus aus dem Alkohol, rein in die Therapie. Relativ zu Beginn sagte meine Therapeutin einen dieser Sätze, die man nicht mehr aus dem Kopf kriegt:
„Sie sollten sich mal auf ADHS testen lassen.“
Klingt erstmal simpel. War’s aber nicht. Denn sie war dafür nicht zugelassen, und einen finden, der das macht? Haha, ja.
2021 hatte ich dann tatsächlich durch ihre Connections einen Termin bei einem echten ADHS-Spezialisten, der normalerweise ausgebucht ist bis zum Sanktnimmerleinstag. Ich war fast drin. Und dann? Ich bekam Corona, musste den heißersehnten Termin absagen und war fortan raus. Thema: stillgelegt. Ich war dann bockig und hab mir den Gedanken zurechtgelegt: „Ach, vielleicht bin ich einfach hochsensibel. Das erklärt doch auch fast alles. Ich brauch doch keine Diagnose.“
Rückblickend betrachtet ein klassischer ADHS-Selbstboykott. Sobald’s unangenehm wird – Rückzug, Tarnmodus, Thema tot.
Blöd nur: die Symptome waren noch immer da. Unbehandelt und ungeordnet.
Dieses diffuse Gefühl, irgendwie nicht richtig reinzupassen. So, als hätte man den Einladungscode zur Welt bekommen, aber der funktioniert einfach nicht. Menschen, die mich nicht verstanden – und ich sie ebenso wenig.
Nicht nur andere Menschen, auch ich selbst hab mir diese Sätze immer wieder an den Kopf geklatscht:
„Reiß dich mal zusammen!“
„Zieh das doch einfach mal durch!“
Aber man ey, wenn ich das könnte, würde ich es doch tun!
Ich find es ja selbst nicht geil, mich als totalen Versager zu fühlen. Ich hab keine Ahnung, wie ich so ein gutes Abitur hingelegt habe. Als es dann an die Berufswahl ging hieß es: “Du bist so klug, du musst studieren!”
Ich habe zweimal versucht zu studieren. Erst Chemie, eineinhalb Jahre. War ne geile Zeit, vor allem in meinen Nebenjobs. Dann Jura, ich hab es fast bis zum Examen geschafft, bevor mich eine Depression lahm gelegt hat und ich davon überzeugt war (und weiterhin bin), dass ich nicht mein Leben lang beruflich streiten will. Rückblickend kann ich sagen: ich profitiere bis heute noch vom Jurastudium. Aber ambitionierte Ziele? Nicht mit mir.
Langfristige Ziele über mehrere Jahre? Für mich war das wie versuchen, ein Labyrinth rückwärts zu durchqueren, während jemand ständig neue Wände aufstellt. Keiner hatte mir beigebracht, dass es auch anders gehen kann.
Fun Fact am Rande: Als ich dann endlich meine Diagnose hatte, erzählte mir meine Mutter, dass schon in der Grundschule eine befreundete Lehrerin angeregt hatte, mich mal testen zu lassen.
Ist nie passiert. Warum nicht? Tja, das bleibt wohl im Reich der Familien-Mysterien.
Schon als Kind war ich impulsiv. Nicht aus Bosheit! Ich wollte nie jemanden verletzen. Aber mein Hirn war oft schon mit dem nächsten Impuls beschäftigt, bevor der erste zu Ende gedacht war.
Einmal hätte ich fast Schulverbot bekommen, weil ich mich so sehr freute, als „mein“ Lehrer aus dem Lehrerzimmer kam, dass ich ihn euphorisch ansprang – leider direkt vor dem stellvertretenden Direktor. Der fand das weniger entzückend.
Diese Spanne zwischen Reiz und Reaktion?
Bei mir damals praktisch nicht existent. Heute ist sie das viel mehr, und das habe ich mir antrainiert, und es kostet mich weiterhin mentalen Hirnschmalz. Es kostet mich echte Mühe, Menschen ausreden zu lassen, vor allem, wenn ich schon weiß (oder glaube zu wissen), was sie gleich sagen werden.

Alkohol als Selbstmedikation – oder: Wie ich jahrzehntelang auf Dauerspannung war
Heute weiß ich: Mein Alkoholismus war keine Charakterschwäche, sondern der Versuch meines Nervensystems, irgendwie zu überleben. Ich habe immer schon extrem intensiv gefühlt, aber mir fehlte jede Landkarte, um das, was da innerlich passierte, auch nur annähernd einzuordnen. Mein Körper war jahrelang im Alarmzustand, als würde ständig irgendwo ein unsichtbarer Feueralarm losgehen. Alkohol war mein Feuerlöscher, wie eine weiche Decke aus Nebel, unter der ich für einen Moment still werden konnte, das Leben “aushalten” konnte. Bis ich irgendwann jeden Tag trinken musste, nur um irgendwie durchzukommen.
Ende 2019, Anfang 2020 spitzte sich alles zu. Es gab Situationen, in denen mir schlagartig bewusst wurde, wie tief ich drinsteckte, und wie nah ich daran war, auch morgens zu trinken. Ich wusste, wenn ich diese Schwelle überschreite, wird es richtig düster. Ich hätte es wohl nicht überlebt.
Also ging ich zu den Anonymen Alkoholikern. Kalter Entzug, aus heutiger Sicht waghalsig und absolut nicht zur Nachahmung empfohlen! Es war gefährlich, körperlich wie psychisch. Aber: Ich habe es geschafft und bin seit Mai 2020 trocken.
Kurzer Einschub: ich habe das nicht aus reiner Willenskraft geschafft!
Für mich ist es vielmehr ein Moment der Gnade, der mir zuteil wurde. So, als hätte mir das Leben einmal kurz die Tür aufgehalten, damit ich durchgehen kann, bevor sie wieder zuschlägt. Ich hatte keinen Zugriff auf meinen Willen, nicht in dieser Zeit. Erst später habe ich gelernt, was Selbstwirksamkeit wirklich bedeutet.
Seitdem gehe ich regelmäßig zu AA. In meiner neuen Stadt habe ich gerade eine Meeting gegründet. Und das, die Gemeinschaft, ist bis heute ein Anker, der mich trägt, weil ich dort auf Menschen treffe, die genau wissen, wie sich das anfühlt, was in einem abgeht, was es für struggle gibt.

Burnouts, Jobwechsel und das Muster dahinter
In der Therapie wurde mir irgendwann klar, was ich selbst jahrelang nur als lose Einzelteile gesehen hatte: Ich habe nie lange in einem Job durchgehalten. Nach spätestens zwei Jahren war Schluss, zweieinhalb waren schon rekordverdächtig. Und das lag nicht daran, dass überall alles furchtbar war. Im Gegenteil: Ich hatte meist gute Beziehungen zu Kolleg*innen, mit vielen bin ich bis heute in Kontakt, die Arbeitsaufgaben waren ok und halbwegs abwechslungsreich. Aber irgendetwas hat immer nicht gepasst, oder besser gesagt: ICH habe nicht hineingepasst.
Wenn ich in ein neues Unternehmen kam, dauerte es meist nicht lange, bis ich die ersten systemischen Schwachstellen erkannt habe. Ich habe ein Auge für Abläufe, die nicht rundlaufen. Für Muster, für Unlogik, für das, was optimiert werden müsste, und das brennt mir dann unter den Nägeln. Das ist mein autistischer Anteil: der Strukturversteher. Und mein ADHS-Anteil? Der steht daneben und ruft: „Jetzt! Sofort! Ändern!“
Das klingt nach einem Dream-Team für Prozessoptimierung, und genau das fanden viele Arbeitgeber auch. Ich habe den Unternehmen geholfen, richtig viel Geld zu sparen oder zu verdienen. Was niemand sah: Den Preis, den ich dafür gezahlt habe.
Denn mit jeder Initiative, jedem „Ich mach das schnell“, habe ich mich tiefer in ein Muster manövriert, das mich ausbrennen ließ. Ich wollte funktionieren, nützlich sein, gesehen werden. Und gleichzeitig konnte ich mich nicht abgrenzen. Kein „Nein“, kein „Nicht jetzt“. Die Versuche, mich zu entlasten, mündeten meist in Mehrarbeit oder einer Kündigung meinerseits. Wenn ich etwas mache, dann mit 200 Prozent – oder gar nicht. Dazwischen gibt es lange nichts.
Gerade zu Beginn meiner Trockenheit war das fatal. Ich saß teilweise im Homeoffice und starrte in den Bildschirm, innerlich leer, ausgebrannt, mit dem Gedanken: „Eine Flasche Wein jetzt…“ Ich habe die roten Fahnen gesehen: Überforderung, emotionale Erschöpfung, Zynismus. Und ich bin trotzdem weitergelaufen. Weil ich dachte, ich muss. Weil ich nicht wusste, dass es auch anders geht. Weil ich mich geschämt habe.
Erst in der Therapie habe ich gelernt, dass diese Art von „innerem Dauerfeuer“ bei ADHS gar nicht so ungewöhnlich ist. Auch die Jobwechsel nicht. Viele neurodivergente Menschen berichten davon, dass sie sich in Arbeitskontexten schnell verbrauchen, weil sie viel leisten, sich anpassen, mit voller Wucht reingehen. Und irgendwann nichts mehr übrig ist.
Heute weiß ich: Mein Burnout kam nicht durch die Arbeit selbst. Sondern durch die Art, wie ich gearbeitet habe. Und durch die tief sitzende Sehnsucht, endlich mal als die gesehen zu werden, die ich bin – nicht nur wegen meiner Leistung, sondern als Mensch.
Die Diagnostik – und was sie (ungefragt) mitbrachte
Die Diagnostik selbst war ein ziemlich intensiver Ritt. Fragebögen über Fragebögen, Gespräche über Lebensgeschichte, Familienstruktur, Alltag, und, ganz klassisch: alte Grundschulzeugnisse, die wie Relikte aus einer anderen Zeit plötzlich wieder Bedeutung bekamen. Das Ganze ging in 2 Terminen über die Bühne, inklusive Differenzialdiagnostik, in der dann auch ein altes Thema aufpoppte, ein Trauma, das ich selbst lange nicht so benannt hätte, das aber plötzlich ziemlich deutlich wurde. Eine kleine Retraumatisierung, die ich hier nicht weiter ausführen möchte, aus Gründen. Aber sie war da. Und sie hat etwas in mir angestoßen. Das wird vielleicht mal Teil eines anderen Artikels.
Später kam noch ein Intelligenztest dazu. Ergebnis: IQ 142, teils Hochbegabung. Klingt beeindruckend, aber in dem Moment war es für mich eher ein sarkastischer Beleg dafür, dass selbst ein überdurchschnittliches Hirn keine Garantie ist, sein Leben irgendwie geschissen zu kriegen.
Dann der lapidare Satz des Psychiaters: “Ja, also ADHS, eindeutig.” Die Frage nach der Medikation: ja oder nein? Der Therapeut stellte die Entscheidung fast gelangweilt in den Raum. Ich dachte mir so: “Ja klar, deshalb bin ich doch hier?!”
Also bekam ich ein Rezept, so mit Papier und zwei Seiten, denn yeah, Betäubungsmittel! Methylphenidat, auch bekannt als Ritalin. “Probieren Sie aus, was funktioniert, wir sehen uns in 3 Monaten wieder.”
Boah, hä? Das wars? Ich fragte nach Selbsthilfegruppen, Unterstützung. Joah, schwer. Gibts kaum, und wenn dann wartet man ewig. Oder es ist weit weg. Da stand ich nun. Erleichtert. Voller Fragen, aber auch erleichtert. Ich habe es mir nicht eingebildet!
Ich habe das dann intensiv mit meiner Therapeutin in einem spontanen Telefontermin besprochen (hach, ich liebe sie einfach, Grüße gehen raus an Frau S.!). Meine größte Sorge war, mich durch die Medikamente zu verlieren. Was, wenn ich nichts mehr fühle? Was, wenn das, was mich ohnehin schon Mühe gekostet hat – diese Verbindung zu mir selbst – noch schwerer wird? Ich hatte Angst, dass da plötzlich jemand anderes „ich“ sagt.
Aber meine innere Dramaqueen war auch sehr aktiv zu der Zeit… Ich war zu der Zeit in einer psychosomatischen Reha, die meine Therapeutin mir empfohlen hatte. Dort konnte ich das Ritalin langsam und unter Aufsicht einschleichen, hab sogar extra eine Verlängerung des Maßnahmenzeitraums bekommen.
Es gab keinen dramatischen „Vorher-Nachher-Knall“. Aber da war ein Moment: Ich saß nach einer Therapie im Gruppenraum, hatte gerade wieder so eine „ganz normale“ Aufgabe gemacht, so viel verstanden und plötzlich heulte ich los. Nicht vor Schmerz, sondern weil es mal still war in mir. Kein inneres Dauerrauschen, keine zwölf parallelen Sender. Vielleicht drei. Ich konnte atmen. Und ich fühlte mich – vielleicht zum ersten Mal – irgendwie… kompletter.
Ich bekam damals auch Rückmeldung von meinen Mitpatient*innen: Dass sie merken, dass ich ruhiger wurde, präsenter. Ich selbst hatte alles genau dokumentiert, getrackt, verglichen. Ich war fast schon verbissen darauf, mich selbst zu verstehen.
Fun Fact: Ich brach alle Rekorde bei den computergestützten Aufgaben in der Arbeitstherapie, mit und ohne Ritalin. Der Unterschied war nicht die Leistung, sondern der Stresslevel. Vorher: Level 9 von 10 bei der kleinsten Herausforderung, wenns mich genervt oder gelangweilt hat. Danach: 4, vielleicht 5. Ich konnte auch langweilige Aufgaben aushalten, ohne innerlich auszurasten. Wie krass?!
Und ich dachte damals: Geil! Früher habe ich acht Stunden Arbeit in vier geschafft – jetzt schaffe ich sie in zwei!
Ich fühlte mich wie Superwoman mit Fokus-Booster.
Bis mir ein ziemlich kluger Mitmensch einen Satz sagte, den ich bis heute nicht vergessen habe:
„Mensch, Katarin. Der Sinn ist doch, acht Stunden Arbeit in sechs zu schaffen – und die übrigen zwei für dich zu nutzen.“
Bumm. Realitätseinbruch. Ich flog hoch, und kam ziemlich schnell wieder runter.
Ich war nicht Superwoman.
Und ich war mit Ritalin kein “besserer, wertvollerer Mensch”. Irgendwie auch erleichternd.

Der Trauerprozess nach der Diagnose
Was ich nicht erwartet hatte: Dass die Diagnose kein Schlusspunkt war, sondern auch der Anfang von etwas ganz anderem. Ich bin in einen Trauerprozess geraten, der mich komplett überrollt hat. Nicht sofort, aber schleichend, tief, lautlos. Und dann war da diese Wut.
Weil ich es plötzlich schwarz auf weiß hatte. Weil ich begriff, wie schwer mein Leben tatsächlich für mich war. Weil ich plötzlich verstehen konnte, wie viel Kraft es mich all die Jahre gekostet hatte, ein Leben zu führen, das nie so ganz für mich gemacht war. Und weil ich jetzt endlich wusste, dass ich mir das nicht eingebildet hatte.
Ich bin nicht einfach nur „empfindlich“ oder „kompliziert“. Ich bin einfach neurologisch anders verdrahtet.
Das bedeutet nicht, dass ich jetzt mit Sonderstatus durch die Gegend laufe, aber es wäre schön gewesen, wenn das System wenigstens einmal gesagt hätte: „Hey, mit dir ist nicht alles falsch. Wir sehen dich. Und wir haben Strukturen, die dich mitdenken.“ Mit System meine ich sowas wie Schulen. Ärzte. Therapeuten. Keiner hatte es auf dem Schirm. Weil: Mädchen, lebt noch, nicht straffällig, gute Noten. Halt bissl nervig und “zu viel”.
Klar, ich hab keine drei Köpfe oder 15 Beine. Aber mein Gehirn funkt eben nicht auf den Standardfrequenzen. Und das nun schriftlich und bestätigt zu haben war gleichzeitig entlastend und schmerzhaft.
Weil ich all die Chancen sah, die vielleicht möglich gewesen wären. Beziehungen, die nicht an Überforderung oder Missverständnissen zerbrochen wären. Studiengänge, die ich vielleicht hätte abschließen können. Wege, die ich mit einem anderen Verständnis für mich selbst hätte gehen können.
Und doch: Es ist fast ein bisschen absurd, was ich ohne Diagnose und ohne passende Unterstützung alles auf die Beine gestellt habe. Als mein Kind auf die Welt kam, hatte ich de facto: nur ein Abitur. Studium abgebrochen, keine Ausbildung, keinen roten Faden.
Also: Umschulung zur Industriekauffrau übers Arbeitsamt. Erster Job. Zwei Jahre später den Wirtschaftsfachwirt gemacht: alleinerziehend, mit Vollzeitstelle, relativ frisch trocken, volle Fahrt voraus. Ich habe das Ding in Rekordzeit durchgeprügelt. Ich weiß bis heute nicht genau, wie ich das geschafft habe.
Wahrscheinlich: Hyperfokus gemischt mit Verzweiflung und motivierenden Fehlannahmen.
Ich konnte mich in Dinge reinbeißen wie ein Terrier im Tunnel. Das war nicht unbedingt gesund, aber es hat funktioniert. Weil da immer diese große Vision war. Ein Bild davon, wie es mal besser werden könnte. Und ich wollte da hin, egal wie.
Heute sehe ich das mit gemischten Gefühlen.
Ja, ich hab’s geschafft – aber nicht, weil das System funktioniert hat, sondern trotzdem.
Und, was habe ich überhaupt geschafft? Ausbildungen für Jobs, die mich ausbrennen, mich nicht nähren, aber anerkannt sind. Was waren sie alle stolz in meiner Familie, während ich litt wie ein geprügelter Hund.
Ich habe gelernt, mich irgendwie durchzubeißen. Weil ich in den Überlebensmodus geschaltet habe, statt wirklich leben zu können.
Und genau das ist der Kern dieser Trauer:
Nicht, dass ich versagt hätte.
Sondern dass ich es so lange alleine schaffen musste: in einem System, das Menschen wie mich bestenfalls übersieht und schlimmstenfalls pathologisiert.
Trotzdem: Heute weiß ich, dass dieses „Ich hab’s ja trotzdem irgendwie geschafft“ nicht die Pointe ist.
Es ist eher der Beweis dafür, wie verdammt anstrengend es war, dass ich einen hohen Preis gezahlt habe, und dass ich eigentlich die ganze Zeit schon alles gegeben habe, ohne es wirklich zu wissen.

ADHS + Autismus = A(u)DHS– zwei Puzzlestücke, die sich mal schubsen, mal umarmen
Falls du dich gefragt hast, wann der Autismus aus dem Titel auftaucht: jetzt ist es so weit.
Denn auch wenn ich hier bisher hauptsächlich über mein ADHS geschrieben habe, ist das nur die halbe Wahrheit. Oder sagen wir: die lautere Hälfte.
ADHS war für mich der erste Schlüssel. Die Diagnose, die mir als erstes die Tür aufgemacht hat, raus aus dem ewigen „Ich bilde mir das bestimmt nur ein“-Hamsterrad. Auf einmal durfte ich mein Leben unter einer anderen Linse betrachten: nicht mehr als Versagen, sondern als Ergebnis von Funktionsweisen, die anders sind – aber nicht falsch.
Aber das war nicht das ganze Bild.
Denn während der ADHS-Teil in mir mit Impulsivität, Hyperaktivität (auch wenn’s oft nur im Kopf tobt), Aufmerksamkeitsproblemen, Dopamin-Dysregulation und einem permanent überfüllten Mental Load jongliert, gibt es da noch einen anderen Teil. Einen stilleren. Einen strukturverliebten. Einen, der Routinen braucht, bestimmte Geräusche nicht erträgt, Gerüche wie Explosionen erlebt und sich manchmal in zwischenmenschlicher Kommunikation fühlt wie ein Alien auf einem interplanetaren Austauschjahr.
Mein autistischer Anteil.
Derjenige Anteil, der auf sensorische Reize brutal reagiert. Ein bestimmtes Parfum kann mir den halben Tag ruinieren. Ich habe Angst vor der Zeit, in der mein Kind anfängt, sich einnebeln in Deos oder Parfüms. Derjenige Anteil, der regelmäßig stimmend vor sich hin klickt, wippt oder summt, um sich zu beruhigen. Derjenige Anteil, der soziale Codes nicht „fühlt“, sondern analysiert oder gar nicht erst rafft. Der, der sich nach Struktur sehnt. Sehr zum Ärger des ADHS-Anteils, der am liebsten täglich spontan das System neu erfinden möchte.
Und dann sind da noch die überlappenden Symptome. Die, die sich nicht klar zuordnen lassen.
Objektpermanenz-Probleme? Du meinst den Apfel, der nach dem Einkauf für sechs Wochen unsichtbar im Kühlschrank wohnt, bis er als biologisches Experiment wieder auftaucht? Oder was nicht auf einem Zettel steht, der in meinem Sichtbereich ist, das gibt es nicht?
Task-Paralyse, exekutive Dysfunktion, emotionale Dysregulation, Hyperfokus? Alles da.
RSD – Rejection Sensitive Dysphoria aka die Angst vor Ablehnung? Absolutes Höllenmaterial.
Und natürlich: Masking. Mein Leben lang war ich Meisterin im „So tun als ob“. Als ob ich dazugehöre. Als ob ich okay bin. Als ob alles gut läuft. Ich habe Rollen gespielt, lächelnd kompensiert, mich angepasst bis zur Selbstaufgabe, und dabei oft nicht mal gemerkt, wie sehr ich mich verliere. Denn ich merkte ja – da ist was anders. Ich will dazugehören (hallo Evolution).
Es gibt Dinge in mir, die ganz klar ADHS sind. Andere, die eher autistisch wirken. Und vieles lebt irgendwo dazwischen, mal als Verstärkung, mal als Widerspruch. Mein Bedürfnis nach totaler Struktur (autistisch) trifft regelmäßig auf meinen inneren Drang nach Abwechslung, Dopamin und Chaos (ADHS). Das ist nicht immer harmonisch. Aber manchmal ergänzen sich die beiden auch überraschend gut.
Spannend wurde es erst, als ich anfing, beides zu sehen. Nicht nur das Offensichtliche, sondern auch die Zwischentöne. Ich habe mich bewusst gegen eine formale Autismusdiagnose entschieden – vorerst. Nicht aus Zweifel, sondern aus Vorsicht und dem Rat meiner Therapeutin folgend. Die aktuelle politische Stimmung rund um psychische Gesundheit, Datenschutz und Register macht mir Angst. Ich will entscheiden, wem ich was anvertraue. Und was würde es denn ändern? Nicht vorhandene Therapiemöglichkeiten herzaubern? Na sicher nicht.
Und trotzdem weiß ich heute: Ich habe beides. Und es macht Sinn. Ich mache Sinn.
Auch wenn mein Innenleben sich manchmal anfühlt wie ein WG-Casting zwischen einem impulsiven Projektmanager auf Red Bull, einem hyperfokussierten Wissenschaftler und einem geräuschempfindlichen Kontrollfreak mit Social-Phobie.
Ich werde in einem anderen Artikel noch tiefer in diese Unterschiede und Wechselwirkungen eintauchen, denn das Thema verdient mehr Raum.
Aber für jetzt reicht vielleicht die Erkenntnis:
Diese Diagnose(n) haben mir nicht nur erklärt, was bei mir anders ist. Sie haben mir erlaubt, überhaupt zu existieren, wie ich bin. Und das ist… viel.
Was auch ohne Diagnose möglich ist
Am Ende bleibt es eine Entscheidung, die dir niemand abnehmen kann: Ob du eine Diagnose willst UND ob du sie gerade bekommen kannst. Der Zugang zu Medikamenten ist dabei ohne Frage ein Gamechanger. Und gleichzeitig: kein Allheilmittel. Ich selbst gehe sehr vorsichtig damit um.
Es heißt oft, bei Stimulanzien wie Ritalin bestehe Suchtgefahr. Das ist gewiss auch so, und ich bin da sehr vorsichtig, gerade mit meiner Suchtgeschichte. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die sagen – wenn du ADHS hast, kommt es eher weniger dazu, als wenn du es “illegaler Weise” nutzt, um besser zu performen. Ich vergesse sogar manchmal, eine Tablette zu nehmen. Ich versuche, mit der Minimaldosis klarzukommen. Ich lege regelmäßig Pausen ein, zum Beispiel am Wochenende, denn ich denke mir: ich bin auch OHNE 38 Jahre lang (halbwegs) klargekommen, und die Dinger sind halt auch ne Belastung für den Körper.
Ich setze das Medikament gezielt ein. Merkwürdiges Beispiel: Ich wollte neulich nach meinem Umzug endlich noch den neuen Keller aufräumen, denn man kam keinen Zentimeter mehr rein. Ich hatte so eine Sehnsucht nach einem begehbaren Keller (Hallo Autismus-Anteil), aber mich dazu aufraffen? Joah, WOCHEN gingen ins Land. Also dann doch mal während der Wirkzeit das aus “Tada-Listenpunkt” genommen. Statt drei Stunden auf dem Sofa sitzen und innerlich mit mir diskutieren: vorhandenen Drive nutzen und durchziehen. Ritalin hilft mir, diesen Startwiderstand zu überwinden (einer meiner persönlichen Highlights an dem Zeug). Es macht nicht, dass ich will, aber es hilft mir, anfangen zu können UND es zu Ende zu bringen.
Was mir am meisten geholfen hat – mit und ohne Diagnose – war etwas anderes:
Verstehen lernen. Beobachten. Auf meinen Körper achten.
Und ein Gedankenspiel:
Ich habe viele dieser Prozesse schon im Rahmen meiner Suchtgenesung begonnen – lange bevor jemand „ADHS“ gesagt hat. Damals habe ich mich gefragt: Was, wenn ich Alkoholikerin bin? Und statt eine formelle Diagnose abzuwarten, habe ich einfach mal angenommen: Was wäre, wenn es so ist – und wie müsste ich dann handeln?
Diese Haltung hat mir das Leben gerettet. Ich musste nicht alles wissen. Ich musste nur aufhören zu verhandeln. (Wichtiger Satz!)
Und genau das habe ich später auf ADHS und Autismus übertragen:
Was wäre, wenn es so ist? Was bräuchte ich dann? Wie müsste ich mich verhalten, um stabil zu bleiben, oder überhaupt erstmal auf die Beine zu kommen?
Ich glaube, viele Menschen warten auf ein Papier, das ihnen erlaubt, sich ernst zu nehmen. Aber oft fängt der Prozess genau vor der Diagnose an: mit der radikalen Entscheidung, sich selbst zu glauben. Auch ohne Stempel.
Natürlich heißt das nicht, dass alles jetzt leicht ist. Ich liege auch heute noch manchmal paralysiert auf dem Wohnzimmerboden, gefangen zwischen „Ich kann gar nichts mehr“ und „Ich habe die beste Idee der Welt!“. Aber ich habe gelernt, diese Extreme nicht mehr als Drama zu lesen, sondern als Teil meines inneren Systems. Und ich habe Wege gefunden, wie ich mich da durch navigieren kann.
Ein Schlüssel dafür war, mein Nervensystem besser zu verstehen.
Wenn ich mich regelmäßig austausche, mir bewusst Ruheinseln schaffe und mich selbst ernst nehme, bin ich viel eher in der Lage, ins Handeln zu kommen.
Ich bin nicht plötzlich “normal”. Sondern ich erlaube mir, nach meinen Bedingungen zu agieren. Ich nutze bewusst verschiedene Ansätze, Tools.
Und was ich inzwischen sicher weiß: Ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit. Ich habe zu viel davon. Für alles, was gleichzeitig auf mich einprasselt: Geräusche, Gedanken, Stimmungen, Erinnerungen, Ideen. Mein System scannt permanent, überall. Es ist nicht still da drin. Nie.
Deshalb sprechen mich die Lehren von Eckhart Tolle so an. Nicht, weil ich sanft im Jetzt verweile wie ein Zen-Mönch im Sonnenuntergang. Sondern weil ich mich manchmal regelrecht an der Präsenz festhalten muss, wie an einem Geländer, wenn alles in mir wieder gleichzeitig losrennen will.
Mein Ego ist dabei ein ganz eigener Fall (es heißt übrigens Schlumpfine :D)
Ich habe viel Ego-Arbeit gemacht und mache sie weiterhin, und es ist alles andere als leicht. Mein Ego ist kein zartes Pflänzchen, das mal kurz gezähmt werden kann. Es ist aktiv, laut, kontrollierend, und es steht jeden verdammten Morgen wieder mit mir auf.
Früher habe ich versucht, es zu bekämpfen. Heute sage ich: Wir haben eine Art Waffenstillstand. Ich habe mich mit ihm verbündet. Ich lasse es mitreden,–undr manchmal, wenn es wieder richtig aufdreht, binde ich es freundlich, aber bestimmt, und lege es geknebelt in den Kofferraum.
Nicht für immer. Aber für den Moment.
Denn diese Reise, mit einem „Special-Effect-Hirn“ in einer neurotypisch getakteten Welt zu existieren – das ist kein Sprint, kein Masterplan, keine spirituelle Einmal-Erleuchtung.
Das ist ein Lebensthema.
Mit Höhen, Tiefen und sehr, sehr viel Selbstbeobachtung.
Aber auch mit der Möglichkeit, wirklich zu erblühen, und zwar auf die eigene, ziemlich unkonventionelle Art.

Fazit: Lass dich auf Wartelisten setzen, aber warte nicht aufs Leben
Das hier ist keine Rede gegen Diagnostik.
Wenn du die Möglichkeit hast: Mach sie. Trag dich ein. Ja, selbst wenn du ein Jahr oder länger wartest – die Zeit vergeht so oder so. Aber warte nicht aufs Leben, während du auf einen Termin wartest.
Ich selbst bin nicht zur ADHS-Diagnostik gegangen, weil es spannend klang. Ich bin gegangen, weil ich gelitten habe. Weil ich irgendwann nicht mehr wusste, warum ich mich so oft im Kreis drehte, warum ich so anders tickte, und warum ich es trotzdem nicht auf die Reihe bekam, „einfach mal zu funktionieren“, so wie scheinbar alle anderen (Spoiler: tun sie meist auch nicht…)
Und obwohl die Diagnose vieles erklärt hat, war sie nicht der Anfang. Der Anfang war viel früher: als ich mir erlaubt habe, das einfach mal anzunehmen.
Nicht: Ich brauche ein Papier, damit ich mich ernst nehmen darf.
Sondern: Was, wenn das wirklich auf mich zutrifft? Was würde ich dann brauchen?
Ob ADHS, Autismus oder irgendwas dazwischen: du musst nicht warten, bis jemand anderes dir sagt, dass du anders bist.
Du darfst das selbst spüren, prüfen, leben. Und du darfst dich damit auseinandersetzen, selbst wenn du gerade keinen Zugang zu Diagnostik, Therapie oder Medikamenten hast.
Bitte renn nicht direkt zu Tante Erna mit einem „Ich glaub ich hab Autismus“. Aber:
Fang an, dich selbst ernst zu nehmen. Schau hin. Und (das ist der wichtigste Teil) such dir Menschen, mit denen du dich darüber austauschen kannst. Menschen, bei denen du keine Show abziehen musst. Die dich sehen, hören, halten.
Ich habe heute eine wunderschöne Wohnung, eine liebevolle Beziehung zu meinem Kind (mit ein paar geerbten Spezialeffekten), und ein Leben, das nicht perfekt ist, aber ich will es auch nicht tauschen. Ich co-therapiere mich. Ich co-reguliere mich. Ich gestalte meinen Alltag mit dem, was ich gelernt habe, nicht gegen mein Gehirn, sondern mit ihm.
Und genau deswegen habe ich auch die Lost Unicorn Society kreiert.
Nicht als „reine Selbsthilfegruppe“, sondern als echter Raum.
Ein raumloser Ort für Menschen, die wissen, dass sie Einhörner in einer Welt voller Kühe sind. Die gelernt haben, dass sie nichts beweisen müssen, um dazugehören zu dürfen.
Hier brauchst du keine Diagnose, um dazuzugehören. Nur den Wunsch, nicht länger allein durchzuhalten.
Ich glaube, dass es genau das ist, was am meisten hilft:
Verbindung. Co-Regulation. Ein „Ich sehe dich“.
Und der Mut zu sagen: „Heute packe ich nichts“, ohne Angst haben zu müssen, dafür bewertet zu werden.
Denn wir alle tragen eine Wahrheit in uns:
Du musst nicht warten, bis du „normal“ bist, um ein gutes Leben zu führen.
Du darfst es dir jetzt schon erlauben. Du darfst dich zumuten.
Und wenn du willst – wir sind hier.
🦄 Willkommen in der Herde.
PS: Falls du dich gerade fragst, ob du dich in meiner Geschichte wiedererkennst – ja, das könnte gut sein. Wir sind viele. Und nein, du musst nicht perfekt, „fertig“ oder diagnostiziert sein, um dich ernst zu nehmen. Fang einfach an, dir zu glauben. Warte nicht auf die große Erlaubnis von außen.
Dein Hirn hat vielleicht Special Effects, aber das heißt nicht, dass du dich durchs Leben schleppen musst. Du darfst schon jetzt anfangen, dein eigenes Drehbuch zu schreiben – mit allen Wendungen, Pausen, Plot Twists.
Und wenn du dabei Gesellschaft willst: 🦄 Die Herde wartet.




Kennst du bereits das Adressverzeichs https://www.adhs-autismus-adressen.de/verzeichnis/